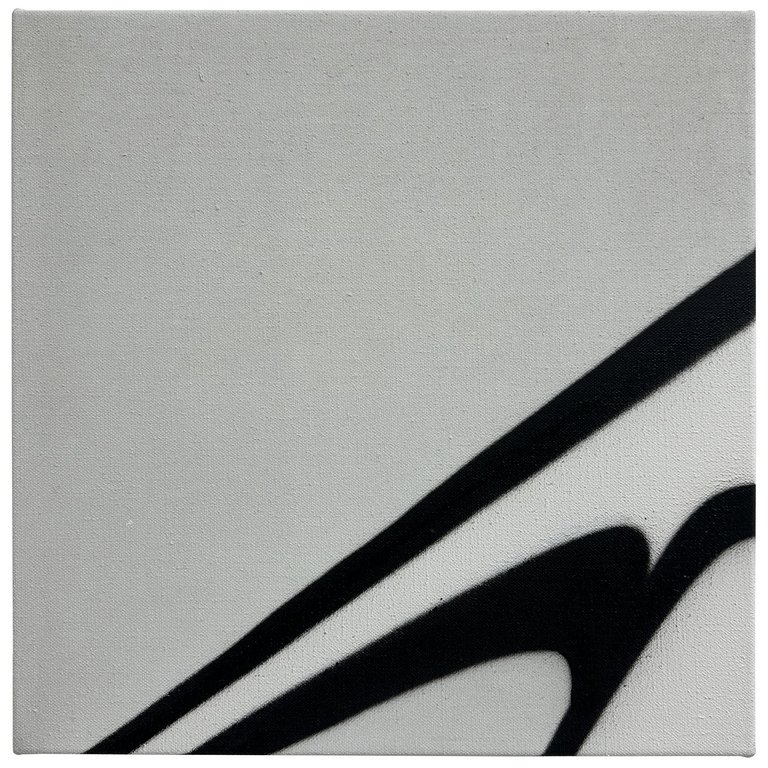Adrian Falkner präsentiert an der grossen Ausstellungswand ein über neun Leinwände gesprühtes Graffiti. Die einzelnen Werke wirken wie aus der Wand herausgebrochene Quader, die nur durch feine, dynamische und schwarze Outlines zusammengehalten werden. Die reduzierte Farbigkeit der Arbeit verstärkt die Eleganz und unterstreicht die feine Linienführung. Durch die Transformation von Graffiti in einen Innenraum verlieren die Arbeiten die traditionellen Merkmale der Graffiti-Szene: Illegalität, schnelles Arbeiten und das In-Beschlag-Nehmen des öffentlichen Raums. Adrian Falkner, auch bekannt als SMASH137, beschäftigt sich seit längerer Zeit mit dieser Thematik und entwickelt mit dieser Arbeit eine neue Form der Präsentation im Kunstraum. Die Hängung der Leinwände kann erkennbar als Graffiti erfolgen, sie können aber auch einzeln sowie in neuen Gruppen arrangiert werden. Die Mehrteiligkeit eröffnet spannende Möglichkeiten, das klassische Graffiti aufzulösen und die Grenzen zwischen traditionellem Graffiti und zeitgenössischer Kunst zu verwischen.
Das zentrale Merkmal der Werke von Mark Jenkins ist die Interaktion mit dem Ort und den Menschen. Die Skulpturen scheinen zu leben, zu stehen oder zu sitzen, doch ihre Aussenwelt bleibt still und unbewegt. Seine Arbeiten zeichnen sich durch hohe Detailgenauigkeit, eine starke Präsenz im Umfeld und oft eine humorvolle, verstörende oder nachdenklich stimmende Wirkung aus. Sie werfen Fragen auf: Wer gehört zu welchem Ort? Welche Stimmen und Geschichten verbergen sich hinter einer scheinbar stummen Figur? Die ausgestellten lebensgrossen, hyperrealistischen Skulpturen von Mark Jenkins, deren Gesichter durch Masken oder Kapuzen verdeckt sind, lösen beim Betrachter Gefühle von Entfremdung, Überraschung und Irritation aus. Sie provozieren ein ästhetisches und emotionales Spannungsfeld zwischen Vertrautheit und Unheimlichkeit, zwischen Nähe und Distanz.
Evol transformiert fünf alte Stromkästen in kleine Wohnmaschinen. Er lenkt die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die strikte geometrische Form der Plattenbau-Architektur und zugleich auf die vielen kleinen Details, die vom Leben in diesen Bauten zeugen – etwa Parabolantennen, unterschiedliche Vorhänge und Klimaanlagen. Schmutz, Beschädigungen und Gebrauchsspuren machen die Individualität der Arbeiten aus, werden zur Besonderheit und ermöglichen Entdeckungsreisen in die Geschichte der Objekte. Die Architektur der Plattenbauten wurde nach der deutschen Wiedervereinigung als unliebsame Hinterlassenschaft einer sozialistischen Ideologie, als problematisches Zeugnis einer Massenarchitektur und als unmenschliche Wohnform verschrien. Diese Wohnmaschinen mit ihrem postsowjetischen, brutalistischen und monumentalen Reiz versucht Evol in seinen Arbeiten im öffentlichen Raum in Erinnerung zu halten.
Adrian Falkner, Mark Jenkins und Evol bleiben damit einer wichtigen Strömung der urbanen Kunst treu: Kunst, die sich nicht nur im Museum versteckt, sondern mitten im Alltag erlebt wird.